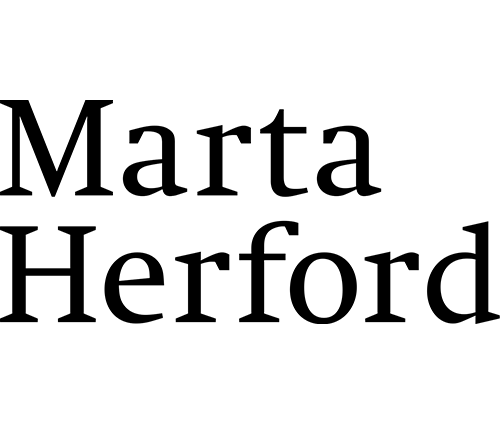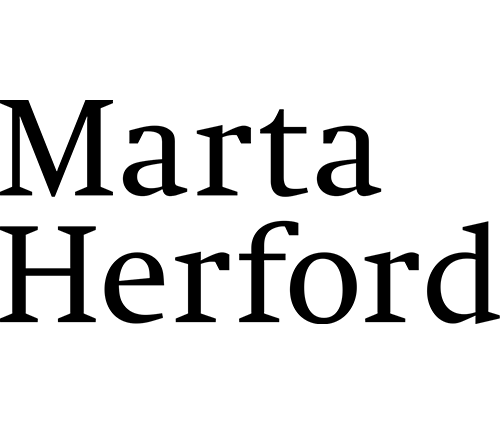Kathrin Sonntag
Das reisende Auge – Reisebericht, 2024
Audiospur, 20:18 Min., Text: Kathrin Sonntag, Sprecherin: Akiko Bernhöft
Ein Freund erzählt mir von einer Reise in die Arktis. Auf dem Forschungsschiff, das neben den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern noch ein Dutzend Touristen durch das Eis manövriert, ist er der Einzige, der keine Kamera bei sich hat. Bei den Ausflügen ins Eis hat er Zeit, dem Geräusch der kalbenden Gletscher zu lauschen, während die Aufmerksamkeit seiner Mitreisenden um ihre Kameras kreist. So sehr sind sie mit dem Fotografieren beschäftigt, dass für‘s Innehalten und Schauen kaum Zeit bleibt.
Allabendlich werden die Kameras aus den Taschen geschält, um einander die „geschossenen“ Trophäen zu zeigen. Auch an dem Tag, als am Horizont ein Eisbär gesichtet wird. Der Motor des Forschungsschiffs wird abgestellt, um den Bären so wenig wie möglich zu stören. Es soll ganz ihm überlassen bleiben, ob er sich nähert oder auf Abstand geht. Der Eisbär entscheidet, näher zu kommen.
Hastig werden die Teleobjektive angelegt und die Auslöser klacken durch die arktische Stille. Mein Freund ist überrascht, wie sehr ihn die Begegnung mit dem Eisbären bewegt hat, aber in den Bildern seiner Mitreisenden findet er sein Erlebnis nicht wieder. Die Bilder sehen genau so aus, wie man sie sich vorstellt, wie Bilder, die man schon hundertmal gesehen hat.
Warum den Eisbären fotografieren? Warum überhaupt fotografieren, wenn man sich dabei – jedenfalls teilweise – um das eigentliche Erlebnis bringt, fragt er. Seine Kritik, dass die Bilder reproduzieren, was an anderer Stelle bereits genauso ins Bild gefasst wurde, ist für seine Mitreisenden keine Kritik, sondern ein Triumph. Sie sind in die Arktis gereist, um dort Bilder zu suchen, die sie schon kennen.
Ich frage mich, mit welchen Bildern im Kopf Gabriele Münter 1898 in die USA reist. In einem Text zu ihren Amerika Fotografien lese ich, dass Kodak 1896, also zwei Jahre bevor sie ihre Reise antritt, bereits die hundert tausendste Kamera verkauft hatte. Münters Bilder sind Teil dieser ersten großen Popularisierungswelle der Fotografie. Die Kamera, eine Kodak Bull’s Eye, wird ihr in den USA geschenkt, wo sie mit ihrer Schwester Emmy Verwandtschaft besucht. Sie ist 23 Jahre alt. Nach zwei Jahren kehrt sie mit rund 400 Bildern nach Deutschland zurück.
Als ich 2003 zum ersten Mal nach New York reise, bin ich 22 Jahre alt. Während meines einmonatigen Aufenthalts mache ich genau sechsunddreißig Bilder. Seltsamerweise zeigen viele dieser Bilder den Boden, als ob mein Blick sich unter der erschlagenden Vertikalität der Stadt wegduckt. Vielleicht sind meine Erinnerungen an die Reise deshalb so bruchstückhaft, weil die Erinnerungshilfen fehlen; Bilder, die wie Lesezeichen markieren, was mir im Moment erinnernswert hätte erscheinen sollen.
Ich vermute, dass meine Zurückhaltung beim Fotografieren damit zu tun hatte, dass mir in New York an jeder Ecke bekannte Bilder begegneten. Die Straßenzüge, die Ampeln, die Taxis, das Empire State Building, alles sah genauso aus wie im Film, was auf mich eine schwindelerregende Wirkung hatte. Von einer Realität, die bereits in so viele Bilder gegossen wurde, wiederum Bilder zu machen, schien sinnlos.
In einer Notiz über die Zeit in den USA schreibt Münter: „Wir fuhren auch einmal zu den Niagarafällen und bewunderten das Naturschauspiel. Davon habe ich gar nichts in Erinnerung behalten. Ich habe nie Vorliebe für großartige Photographier-Ansichten. So ging auch dieser Eindruck für mich vorbei.“
Ich kann Münters Bilder aus Amerika nicht betrachten, ohne über die Voraussetzung ihrer Entstehung zu stutzen. Die Bull’s Eye ist ihre erste Kamera. Sie hat keine fotografischen Vorkenntnisse. Das Medium ist für sie genauso neu wie die Eindrücke, die sie damit sammelt. Viele Entwicklungen, die heute für uns im Umgang mit der Fotografie ganz selbstverständlich sind, standen noch aus.
Heute ist die Welt fotografisch kartiert und wird permanent weiter kartiert. Wir sehen und machen täglich Fotos. Sie dringen auf uns ein und bebildern unsere Vorstellung der Welt. Ich stelle mir vor wie es wäre zu fotografieren, ohne diesen Ozean fotografischer Bilder im Hinterkopf. Im Gegensatz zu mir und den Arktistouristen aus dem 21. Jahrhundert, steht Münter 1899 kein fotografischer Bildkosmos vor Augen. Sie kann in der texanischen Steppe nicht Bilder suchen, die sie schon kennt, denn es gibt sie noch nicht.
Die meisten Bilder, die Münter auf ihrer Amerika Reise macht, zeigen Menschen. Sie fotografiert ihre Verwandten und macht Aufnahmen von deren Nachbarn und Bekannten. Viele dieser Porträts sind gestellt. Die Porträtierten blicken direkt in die Kamera. Sie wissen, dass sie fotografiert werden. Trotzdem liegt eine fesselnde Direktheit in den Blicken, die ungekünstelt wirkt. Vielleicht, weil das Medium nicht nur für Münter neu ist, sondern auch für diejenigen, die sie aufnimmt. Die Menschen haben noch keine Fotogesichter.
Münter nimmt die Kamera mit auf Ausflüge und fotografiert von der Kutsche aus die amerikanische Landschaft. Sie macht Architekturaufnahmen, dokumentiert Festumzüge und Ereignisse wie den Brand eines öffentlichen Gebäudes. Bei der ersten Begegnung mit den Bildern verblüffen mich am meisten die spontanen Aufnahmen, die Münter von Menschen auf der Straße macht. Drei Frauen im Sonntagskleid, die an ihr vorbeilaufen. Ein Mädchen, auf der Straße stehend, von hinten aufgenommen, die sich unbeobachtet glaubt und ihr Kleid zurechtrückt. Ein Junge in New York, der eine Spielzeugpistole auf Münter richtet. Diese Bilder passen so gar nicht zu den statischen Studioaufnahmen, die ich mit der Zeit um 1900 assoziiere.
Münter interessiert sich auch für die Linien, die das Gestänge eines Schiffsauslegers in den Himmel zeichnen. Beim Durchschauen der Bilder bleibe ich immer wieder an dieser Fotografie hängen. Ich glaube, weil sie für mich so deutlich markiert, dass Münter auch Aufnahmen macht, die nicht unbedingt für die Augen anderer bestimmt sind. Sie findet mit ihren Bildern eigene Antworten auf die Frage, was fotografierenswert ist und was mit der Kamera ins Auge gefasst werden kann.
Die Ausschnitte und Kompositionen, die sie beim Blick durch den Sucher der Bull’s Eye wählt, wirken entschieden und zielsicher. Noch bemerkenswerter erscheint mir, dass Münter so leichtfüßig darüber hinweggeht, das Medium als eine rein soziale Währung zu betrachten. Sie benutzt die Fotografie als visuelle Notiz. Dabei navigiert sie nach ihrem eigenen Kompass und findet Bilder, die ihrer Zeit voraus sind.
Ich nehme eine Lupe zur Hand und schaue mir Münters Bilder näher an. Das Rund der Linse am Auge, mache ich eine eigene Reise durch ihre Bilder und finde dabei Details, die mir vorher nicht aufgefallen waren: eine mysteriöse Hand, die in ein dunkles Tuch gewickelt ist, der schwebende Schatten eines Jungen, eine geisterhafte Lichterscheinung und ein Mädchen, das hinter einem Zaun versteckt die Szene beobachtet, die Münter fotografiert.
Mit der Kamera einen Ausschnitt aus der sich abspielenden Wirklichkeit herauszulösen, erfordert schnelle Entscheidungen. Neben den Einstellungen an der Kamera muss man den Ausschnitt wählen und die Position des Bildgegenstandes im Verhältnis zu seinem Umraum bestimmen. Es ist nicht immer möglich zu prüfen, was bis ins kleinste Detail auf der Fotografie zu sehen sein wird.
Der Akt des Fotografierens gleicht einem Tanz mit der Wirklichkeit, bei dem man mitunter erst später merkt, wer geführt hat. Es kommt vor, dass einem die Wirklichkeit im Nachhinein mit einem störenden Detail einen Strich durch die Rechnung macht. Manchmal sind es aber gerade die unbeabsichtigten Details und Zufälle, die ein Bild zu dem machen, was es ist. Bemerkenswert an Münters Umgang mit der Fotografie ist, dass sie sich scheinbar mühelos in diesen Tanz einfindet und sich ohne Scheu in die Unberechenbarkeit des Moments lehnt.
Münter macht Bilder von einer Welt, in der die Fotografie noch keine großen Spuren hinterlassen hat. Möglicherweise agiert sie deshalb so frei und unbefangen mit dem neuen Medium. Sie entdeckt die Fotografie zu einem Zeitpunkt, als sie selbst – künstlerisch gesehen – ein nahezu unbeschriebenes Blatt ist. Wir schauen uns die Fotografien von Gabriele Münter an, weil sie eine berühmte Malerin war. Die Fotografien aus Amerika macht sie aber zu einem Zeitpunkt, als sie diese Malerin noch nicht ist.
Ich glaube nicht, dass Münters Fotografien mit der Absicht entstehen, Kunst zu sein oder in einer Ausstellung gezeigt zu werden. Auch später hat Münter sich nie dazu entschieden, ihre Fotografien auszustellen. Sie hat sich nicht dazu geäußert, welche Bedeutung das Medium für sie hatte oder ob sie ihre Fotografien überhaupt als Teil ihres Werks verstanden hat. Den einzigen Hinweis auf ihr Verhältnis zur Fotografie liefern die Bilder selbst.
Ich beginne in meinem Fotoarchiv nach Bildern zu suchen, die Ähnlichkeit zu denen von Münter aufweisen. Das Spiel spielt sich jeden Tag ein bisschen anders. Mal fällt mir ein konkretes Bild ein, das zu Münters passen könnte, mal klicke ich ziellos durch die Ordner meiner Bildersammlung, bis ich unverhofft ein Bild finde, das sich mit einer der Aufnahmen von Münter reimt.
Ich suche nach Entsprechungen, nach ähnlichen Motiven und Details oder assoziativen Korrespondenzen. Mit den Gegenüberstellungen versuche ich mir einen Reim darauf zu machen, was die Fotografien der dreiundzwanzigjährigen Gabriele Münter mit Fotografien zu tun haben könnten, die ich hundertzwanzig Jahre später gemacht habe.
Was übrig bleibt, sind Fragen. Was haben diese Bilder wirklich miteinander zu tun? Was bedeutet es, dass sich trotz des langen zeitlichen Abstandes Ähnlichkeiten finden lassen? Was sagt das über Münters und meine Absichten beim Fotografieren aus – oder allgemeiner: Was sagt es darüber aus, wann und warum fotografische Bilder entstehen?
Bei der Auswahl meiner Fotografien lasse ich mich von den Motiven Münters leiten. Weil der Großteil ihrer Fotografien Menschen zeigt, wähle auch ich Bilder von Menschen aus. Daraus ergibt sich für mich am Ende, analog zu Münters Familienbildern, ein Gruppenportrait der Menschen, mit denen ich mein Leben teile und die ich zu meiner erweiterten Familie zähle. Ich stelle fest, dass ich Fotografien ausgesucht habe, die ich bis jetzt nicht geplant hatte, öffentlich zu zeigen und finde darin ein weiteres unerwartetes Echo zu Münters Fotografien.
Mir fällt auch auf, dass die meisten Porträts, für die ich eine Entsprechung in meiner Sammlung finde, Frauen zeigen. Das hat zur Folge, dass mir beim Betrachten der Gegenüberstellungen vor allem die Blicke von Frauen begegnen.
Ich denke daran, dass Frauen in Deutschland 1899 noch kein Wahlrecht hatten. Münters Fotografien sind auch deshalb besonders, weil sie in einer Zeit entstehen, in der aktives, selbstbestimmtes Handeln von Frauen gesellschaftlich nicht erwünscht war. Dass sich Gabriele und Emmi Münter in dieser Zeit auf eine Reise nach Amerika machen, ist gleichermaßen beeindruckend und inspirierend und zeigt den Mut und die Abenteuerlust dieser beiden Frauen. Die Kamera in Münters Hand wird dabei zu einem Werkzeug der Entdeckung und gibt ihr die Freiheit in eigener Regie der Welt zu begegnen.
Trotz der vordergründigen Ähnlichkeiten lassen sich für mich beim Betrachten der Bilder auch gesellschaftliche Veränderungen ablesen, die in den letzten hundertzwanzig Jahren stattgefunden haben. Was mir gleich geblieben zu sein scheint, ist, dass Fotografie nicht nur von ihren Gegenständen erzählt, sondern auch von den Personen, die fotografieren. Sie zeigen – damals, wie heute – was wir für anschauenswert halten und in welchen Lebensumständen wir uns befinden.
Und dann ist da noch etwas, das im Zwischenraum von Münters und meinen Fotografien stattfindet. Die visuellen Reime der Gegenüberstellungen, eröffnen einen assoziativen Zwischenraum, der auf rätselhafte Weise einen eigenen Klang ergibt und dabei mühelos die große Zeitspanne überbrückt, die zwischen den Bildern liegt. Vielleicht verrät dieser Zwischenraum etwas darüber, dass fotografische Bilder zwar die Vergangenheit zeigen, aber immer auch vom Blick der Gegenwart geprägt sind.
Als ich heute Morgen auf mein Handy schaue, hat mein Telefon für mich eine Diashow mit dem Titel „Schneetage im Laufe der Jahre“ zusammengestellt. Das Titelbild, der KI generierten Bildabfolge, zeigt das Münter-Haus im Schnee. Anfang des Jahres bin ich nach Murnau gereist, um mir das Haus anzuschauen, in dem Gabriele Münter bis zu ihrem Tod gelebt hat.
Auf den Wipfeln der Bäume, die die Autobahn säumen, liegt Schnee – so viel Schnee, dass ich mich in meine Kindheit zurückversetzt fühle. Je näher ich Murnau komme, desto dunkler und nebliger wird es.
Als ich mich am nächsten Morgen vom Hotel aus auf den Weg zum eingeschneiten Münter-Haus mache, verkürzt der Nebel immer noch die Sicht. Feuchtigkeit hat sich an den Ästen und Zäunen abgesetzt und alles mit einem zarten Kristallpanzer aus Eisdornen überzogen. Der Ort kommt mir unwirklich vor, so als wäre ich durch die Nebelschwaden nicht nach Bayern, sondern an einen viel weiter entfernten Ort gereist.
Auch im Münter-Haus stellt sich keine Klarsicht ein. Ich fotografiere zwei Tage lang, aber die Hoffnung Münter dadurch näherzukommen, löst sich nicht ein. Als ich mein Kameraequipment zusammenpacke, denke ich an die Bilder, die Münter von der Kutsche aus von der weiten amerikanischen Landschaft gemacht hat und an die Stille, die eindringlich in ihnen nachklingt. In diesen Bildern, auf denen Münter mit der Kamera in die Leere blickt, ist sie mir plötzlich präsent. In der Stille der Bilder ist ihre Anwesenheit auf seltsam deutliche Weise spürbar.
Am zweiten Tag hat sich der Nebel in Murnau gelichtet und unter einem strahlend blauen Himmel zeigt sich die Landschaft, die ich aus den Malereien von Münter kenne. Bevor ich meine Rückreise antrete, laufe ich durch einen nahegelegenen, von Eichen gesäumten Wanderpfad zu einem Aussichtspunkt. Die Strahlen der Sonne schmelzen den Schnee und aus den Baumkronen lösen sich rieselnde Kaskaden, die für kurze Zeit glitzernde Vorhänge zwischen die Eichen ziehen.
Nach den nebeligen Tagen sind die Weite und Klarheit berauschend. Weil ich schon den ganzen Vormittag im Münter-Haus fotografiert habe, ist mein Blick offen und ungefiltert. Alles, was ich sehe, ist eine Sensation. Kopflos beginne ich zu Fotografieren. Das Tropfen der schmelzenden Märchenlandschaft fühlt sich an wie eine tickende Uhr. Schon während ich fotografiere, merke ich, dass ich die Kamera nicht in die Hand genommen habe, um Bilder zu machen, sondern um sie zwischen mich und die Situation zu schieben, die mich mit ihrer gleißenden Schönheit überwältigt.
Ich denke an die Arktis Touristen und daran, dass die Wirklichkeit manchmal schwer auszuhalten ist. Manchmal fotografiert man nicht, um Bilder zu machen, sondern um einen Abstand herzustellen.
Ich halte inne und höre meinen eigenen Atem in der Stille. Dann denke ich an Münter und erinnere mich daran, dass der Prozess des Fotografierens selbst zu einer Reise werden kann. Eine Reise, bei der man in einen Dialog mit der Wirklichkeit tritt und beim Schauen einen Rhythmus anschlagen kann, der die eigene Wahrnehmungsroutine unterbricht. Die Fotografie hat viele Schauplätze. Man kann sie benutzen, um Bilder zu suchen, die man schon kennt – mitunter erlaubt sie einem aber auch Bilder zu finden, nach denen man nicht gesucht hatte.